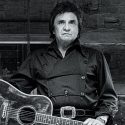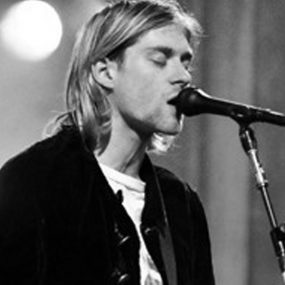Popkultur
Highway 61: Ein Roadtrip entlang der Entstehungsgeschichte des Blues

Er ist als die “Hauptstraße des Delta” bekannt und der Grund liegt auf der Hand: Der Highway 61 erstreckt sich über 1.400 Meilen (2.300km) zwischen New Orleans, Louisiana und Wyoming, Minnesota. Für unsere Zwecke konzentrieren wir uns auf den Abschnitt von der “Wiege des Jazz” bis nach Memphis, der oft als “Highway Of The Blues” bezeichnet wird. Dieses Gebiet ist auch als das Mississippi-Delta bekannt.
Hört euch hier unsere Playlist Blues für Anfänger an und lest weiter:
Das Delta beginnt in Vicksburg, 300 Meilen von der Flussmündung entfernt, und erstreckt sich über 250 Meilen nordwärts bis nach Memphis. Die riesige, mandelförmige Schwemmebene entstand vor Tausenden von Jahren durch Überschwemmungen des großen Mississippi im Westen und des kleineren Yazoo im Osten. Diese weite Ebene ist ein Gebiet des Baumwollanbaus, Cotton Country.
Bis 1820 war das Delta ein kaum entwickeltes Gebiet mit viel Laubwald. Um 1835 begannen Siedler damit, das Delta abzuholzen, um Baumwolle anbauen zu können. Nach dem Bürgerkrieg war der Wald komplett verschwunden und über die ganze gewaltige Fläche entstanden Plantagen. Das Delta wurde zu einem Katalysator, eine unwirtliche Gegend, die nur eine Art von Musik hervorbringen konnte – den Blues.
Am 27. November 1936 nahm Robert Johnson in San Antonio, Texas, seinen Crossroad Blues auf. Das war nicht nur der Beginn der Legende um ihn selbst, sondern auch der fortdauernden Faszination mit dem Highway 61. Es ist die Geschichte von Johnson, wie er an einer Kreuzung, vermutlich am Highway 61, seine Seele an den Teufel verkauft. Seit 80 Jahren beschäftigt dieser Mythos die Blues- und Rock’n’Roll-Welt.
Bewohner des Delta sind mittlerweile schon genervt davon, dass sie immer wieder von aufgeregten Bluestouristen gefragt werden, wo sich denn jene sagenhafte Kreuzung befindet. Aber nicht alle machen sich die Mühe zu fragen. Einige fahren einfach zu der Stelle, an der sich der Highway 61 und Highway 49 kreuzen und machen dort ihr Foto. Was sie nicht wissen ist, dass diese Kreuzung mindestens eine halbe Meile von der entfernt ist, die zu Johnsons Lebzeiten dort war. Wie dem auch sei, Johnson sang natürlich von einem mythischen Ort und nicht von einer tatsächlichen Straßenkreuzung.
Als Bob Dylan 1965 sein Album Highway 61 Revisited veröffentlichte, wurde die Legende weiter angeheizt. Songs von Künstlern wie Mississippi Fred McDowell (61 Highway) und Roosevelt Sykes, Jack Kelly & His South Memphis Jug Band und Will Batts (Highway 61 Blues), die zwischen Johnsons altem Song und Dylans Album erschienen, taten ein Übriges, um den Mythos am Leben zu erhalten.
Der Blues eroberte von Memphis aus die Welt. Er fand seine Heimat in der Beale Street, etwas den Highway 61 hinauf. Die Beale Street ist die legendäre Musikmeile und ein Zentrum der Afro-Amerikanischen Kultur für Memphis und Umgebung.
In den 1920ern machten sich Labels wie Columbia, OKeh, Victor und Bluebird auf den Weg nach Memphis und ließen durch ihre Scouts verkünden, dass wer ein paar gute Songs spielen konnte, sich zu einer bestimmten Zeit vorstellen sollte. Unter denen, die dieser Einladung folgten, waren zum Beispiel The Memphis Jug Band, Cannon’s Jug Stompers, Frank Stokes, Ishman Bracey, Tommy Johnson und Sleepy John Estes. Etwas später, im Jahr 1941, fuhr Alan Lomax zu Stovall’s Plantation, in der Nähe von Clarksdale, und machte dort die erste Aufnahme von Muddy Waters.
Die Liste derer, die direkt entlang des Highway 61 geboren wurden, liest sich wie ein Who is Who des Blues:
In und um Jackson: Bo Carter, Elmore James, Ishman Bracey, Tommy Johnson und Charley Patton.
Vicksburg: Willie Dixon
Forest: Arthur Crudup
Yazoo City: Tommy McClennan
Belzoni: Otis Spann
Leland: Jimmy Read
Indianola: BB King and Albert King
Scott: Big Bill Broonzy
Teoc: Mississippi John Hurt
Ruleville: Jimmy Rogers
Glendora: Sonny Boy Williamson
Vance: Sunnyland Slim
Clarksdale: John Lee Hooker, Ike Turner, Little Junior Parker, Willie Brown
Stovall: Eddie Boyd
Riverton: Son House
Tunica: James Cotton
Hernando: Robert Wilkins
Horn Lake: Big Walter Horton
Viele dieser Blues Legenden begannen ihre Karriere mit Auftritten bei Picknicks, Miet-Parties (bei denen Geld für die Miete eingesammelt wurde) und samstäglichen Nachbarschaftsfesten im ganzen Delta, bei denen vor allem reichlich Fisch frittiert wurde. Sie nahmen den Zug nach Memphis und dann weiter nach Chicago, Detroit oder in eine der anderen großen Städte im Norden.
Ihre Songs erzählen oft von dem harten Leben in dieser kargen Landschaft. Sie kannten sich mit dem Blues aus, weil sie ihn lebten. Die Songs der Bluesmusiker aus der Zeit vor dem Krieg haben einen nüchternen Charakter, der oft eine weichere Note erhielt, nachdem sie das Delta verließen. Aber wie sagt das alte Sprichwort: “Du kannst den Mann aus dem Delta herausholen, aber Du bekommst nie das Delta aus dem Mann heraus.”
John Grisham schrieb im Vorwort zu seinem Buch Visualizing The Blues: “Das Leid bereitete den Weg für die Kreativität”. Diese Männer (und wenige Frauen), die im Delta aufwuchsen und anfingen, Bluesmusik zu machen, taten dies nicht wegen des Geldes, sondern als Flucht. Jeder Blues-Fan sollte das Delta einmal besucht haben. Die Musik wird danach viel mehr Bedeutung haben und die visuellen Eindrücke werden euch für immer begleiten.
Wir haben 13 Orte entlang des Highway 61 rausgesucht, die ihr auf jeden Fall besuchen solltet
Rhythm Night Club
5 St Catherine Street, Natchez, Mississippi
Dieses kleine Gebäude ist kein Nachtclub mehr. Stattdessen erinnert es an den Natchez Brand vom 23. April 1940, bei dem mehr als 200 Menschen ums Leben kamen. Bluesfans auf der ganzen Welt wissen durch Howlin’ Wolfs The Natchez Burning von 1956 von dieser Tragödie.
Catfish Row Museum
913 Washington Street, Vicksburg, Mississippi
Wenn der Besucher die Geschichte der an den Ufern des Mississippi gegründeten Stadt in sich aufnimmt, dann bringt ihm das Catfish Row Museum nicht nur die Musik aus der Gegend näher, sondern auch ihr reiches Erbe an Essen, Religion und visueller Kunst.
Highway 61 Blues Museum
307 North Broad Street, Leland, Mississippi
Das Highway 61 Blues Museum ist klein, aber sehr einladend. Es befindet sich im Old Montgomery Hotel und ist Teil der örtlichen Bemühungen, an den Delta Blues zu erinnern. Dazu gehören auch Wandmalereien, die vom Leland Blues Project in Auftrag gegeben wurden.
Charley Pattons Grabstätte
Holly Ridge Cemetery, Holly Ridge Road, Mississippi
Auf seinem Grabstein wird Patton zurecht als “The Voice Of The Delta” beschrieben. Für den Besuch seiner Ruhestätte muss man einen kleinen Abstecher weg von der Hauptroute machen, aber es lohnt sich, dem Mann, mit dem alles begann, Respekt zu zollen.
BB King Museum
400 Second Street, Indianola, Mississippi
Das Museum dokumentiert und würdigt die Kariere des als Riley B King geborenen Musikers mit Liveveranstaltungen und Ausstellungen und darf auf keiner Bluesreise fehlen.
Robert Johnsons Grabsteine
Little Zion Missionary Baptist Church, Money Road, Greenwood, Mississippi
Drei Grabsteine auf drei unterschiedlichen Friedhöfen in Greenwood nehmen für sich in Anspruch, die letzte Ruhestätte der ersten Blueslegende der Welt zu sein: 1991 errichtete Sony einen obeliskförmigen bei Mount Zion. ZZ Top bezahlten für einen zweiten auf dem Gelände der Payne Chapel. Und der Stein an der Little Zion Missionary Baptist Church kommt spannenderweise von einer gewissen Rosie Eksridge, die im Jahr 2000 im Alter von 85 Jahren behauptete, dass ihr Mann, Tom “Peter Rabbit” Eskridge, Johnson im August 1938 am hinteren Ende des Friedhofs beerdigt hatte.
Dockery Farms
229 MS-8, Cleveland, Mississippi
Dockery Farm war eine 25.600 Morgen große Baumwollplantage und Sägewerk am Sunflower River am Highway 8 zwischen Cleveland und Ruleville. Sie wurde kürzlich zu einem Wahrzeichen Mississippis ernannt [link to: https://www.udiscovermusic.com/news/mississippis-dockery-farms-named-blues-landmark]. Der Ort gilt als die Geburtsstätte des Blues; Farmpächter, die für Will Dockery arbeiteten, lebten in Gemeinschaftsunterkünften, wo sie Musik machten. Daraus entstand der Blues. Charley Patton der “Gründer des Delta Blues”, war einer der ersten Siedler auf Dockery. Auch Robert Johnson, Howlin’ Wolf und Pops Staples waren zu der einen oder anderen Zeit hier, nahmen Einflüsse auf und formten ihren jeweils eigenen Stil. Jetzt gehört das Grundstück der Dockery Farms Foundation und ist für Besucher geöffnet. Private Führungen können vorab gebucht werden.
GRAMMY Museum Mississippi
800 West Sunflower Road, Cleveland, Mississippi
Das GRAMMY Museum Mississippi deckt zwar ein breites Feld ab und würdigt neben der Musik aus dieser Gegend auch die Beatles, die Geschichte der elektrischen Gitarre und den texanischen Bluesmusiker Stevie Ray Vaughan mit diversen Ausstellungen. Aber selbstverständlich widmet sich das Museum auch dem Blues und seinem Einfluss auf den Jazz, Rock’n’Roll und Hip-Hop.
Devil’s Crossroads
599 North State Street, Clarksdale, Mississippi
Die ursprüngliche, sagenumwobene Kreuzung, die Robert Johnsons Song und seiner Legende zugrunde liegt, ist zwar mittlerweile in den Untiefen der Geschichte verlorengegangen, aber ein Foto an der Markierung an der Kreuzung von Highway 61 und Highway 49 gehört auf jeden Fall dazu.
Delta Blues Museum
1 Blues Alley, Clarksdale, Missisippi
Das Delta Blues Museum wurde 1979 gegründet und befindet sich heute im Frachtzentrum von Clarksdale, welches seit 1918 existiert. Mit seiner 78s-Sammlung, speziellen Filmabenden und spannenden Ausstellungen ist das Museum ein Pflichthalt im “Heimatland des Blues”.
Riverside Hotel
615 Sunflower Avenue, Clarksdale, Mississippi
Seit 1944 ist das Riverside eine beliebte Unterkunft für Musiker auf Tour, darunter Namen wie Sonny Boy Williamson II und Ike Turner. Davor war es das GT Thomas Hospital, welches traurige Berühmtheit erlangte, als Bessie Smith, die “Kaiserin des Blues”, am 26. September 1937 nach einem Autounfall dort verstarb.
Stovall Farms
4146 Oakhurst Stovall Road, Clarksdale, Mississippi
Stovall Farms befindet sich kurz außerhalb von Clarksdale. Muddy Waters lebte hier für einen großen Teil seiner frühen Jahre und hier nahm Alan Lomax zwischen 1941 und 1942 mit ihm auf. Das Gebäude, in dem er lebte, wird jetzt vom Delta Blues Museum bewahrt.
BB King’s Blues Club
143 Beale Street, Memphis, Tennessee
Von den vielen BB King Blues Clubs in den USA war der in der Beale Street der erste. Er wurde 1991 im Herzen der Livemusikmeile von Memphis eröffnet.
Das könnte dir auch gefallen: