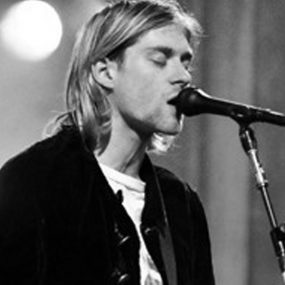Popkultur
Die musikalische DNA von Bob Marley

Wer Reggae sagt, meint in den meisten Fällen Bob Marley. Kaum jemand hat in der Musikgeschichte ein ganzes Genre dermaßen dominiert wie der Jamaikaner. Das ist einerseits schade, weil Reggae noch viel mehr zu bieten hat als die Musik des Rastafaris. Es ist zugleich jedoch nur die logische Konsequenz seines Schaffens. Gemeinsam mit den Wailers war Marley dabei, als der neue Sound in Jamaika seinen Anfang fand und trug ihn in die Welt hinaus.
Leicht hatte er es dabei nicht immer, denn außerhalb seines eigenen Landes wurde der Offbeat-basierte Sound nur zögerlich aufgenommen. Marley wurde stattdessen zu einer internationalen Ikone des Undergrounds und der Gegenkultur. Seine Musik war ein hoffnungsvoller Protest gegen das Übel in der Welt. Doch Reggae entstand nicht im luftleeren Raum und auch Marley konnte auf eine ganze Reihe von wegweisenden Musikern zurückblicken, die ihn entweder inspirierten oder auf seiner Reise unterstützten. Ein Blick auf seine musikalische DNA verrät uns, wer.
Hör dir hier Bob Marley musikalische DNA als Playlist an während du weiterliest:
1. The Drifters – This Magic Moment
Schon früh begann sich der junge Marley für Musik zu interessieren. „Wie alles angefangen hat, weiß ich nicht“, gab er in einem Interview zu. „Aber ich weiß, dass meine Mutter Sängerin war. Meine Mutter ist sehr spirituell, wie eine Gospel-Sängerin. Sie schreibt Songs. Ich habe zuallererst sie singen gehört und fing so an, Musik zu lieben.“
Mit Neville „Bunny“ Livingston fand er einen Freund, der genauso musikversessen war wie er selbst. Gierig sogen die beiden Teenager jeden neuen Sound auf. Bunny bastelte sich aus Kupferdrähten, einer Sardinenbüchse und einem Bambusrohr eine Gitarre, mit der die beiden ihre ersten Songs spielten. Wo ein Wille ist, da ist schließlich auch ein Weg! Neben Calypso, Ska und Rhythm and Blues stand die Musik der Vokalgruppe The Drifters hoch in Marleys Kurs. „Mein größter Einfluss waren die Drifters – Magic Moment, Please Stay, sowas. Also dachte ich mir, ich sollte eine Gruppe zusammentrollen.“
2. Fats Domino – Be My Guest
Gesagt, getan. Zuerst versuchte sich Marley mit seinen Kollegen noch am Ska-Stil, der sich in den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren in Jamaika ausprägte. Mit dem Ska schuf sich Jamaika ein ganz eigenes Musikgenre, das regionale Stile wie Mento und Calypso mit dem Rhythm and Blues-Sound des schwarzen Amerikas vereinte. Insbesondere die Musik von New Orleans-Musikern wie Fats Domino war beliebt. Songs wie Be My Guest bildeten mit ihren synkopierten Gitarrenakkorden die Blaupause für die unwiderstehlichen Ska-Grooves.
Im Rhythm and Blues fand die jamaikanische Bevölkerung eine Musik, die viel eher zu ihnen sprach als der weiße Rock eines Elvis Presley. Über Transistorradios und die ersten Soundsystems verbreitete er sich über die ganze Insel, bis irgendwann jede noch so obskure Platte totgespielt war. Mit dem Aufkommen von Ska fand die Unabhängigkeitserklärung Jamaikas im Jahr 1962 ihren perfekten Soundtrack: Die Stimmung war ausgelassen, eine neue kulturelle Identität begann sich zu bilden.
3. Skatalities – Freedom Sounds (Live)
Songs wie Freedom Sounds von den Skatalities drückten den Spirit dieser Zeit am besten aus. Die Skatalities gehören zu einer der bekanntesten Gruppen der ersten Ska-Welle und rekrutierten ihre Mitglieder aus der regionalen Musikszene. Als veritable Supergroup waren sie sich aber keineswegs zu schade, um mit einem Haufen unerfahrenen Burschen ins Studio zu gehen, um deren erste Single mit dem Titel Simmer Down aufzunehmen.
Wer diese Burschen waren? Nun, sie nannten sich die Wailers und wurden von Peter Tosh, Bunny Wailer und einem gewissen Bob Marley angeführt. Mit dem Song wollte die junge Band die „rude boys“ in den Ghettos Jamaikas dazu auffordern, ihr gewalttätiges Treiben zu überdenken. Ob’s geholfen hat? So oder so hätte Marley wohl kaum einen passenderen Einstieg feiern können. Mit den Skatalities im Rücken und der Vision einer friedlicheren Welt startete er seine Karriere auf dem richtigen Fuß. Nur musikalisch sollte er sich noch etwas umorientieren.
4. Toots & The Maytals – Do The Reggay
„Reggae begann mit Fats Domino“, soll Marley einmal gesagt haben. Tatsächlich lässt sich eine direkte Verbindungslinie vom Sound des Rhythm and Blues aus New Orleans über den Ska-Hype hin zur Entstehung des Genres ziehen. Wie aber genau entstand der Reggae? Musikhistoriker sind sich uneinig, verbrieft sind allerdings die Wurzeln des Genres im Ska und dem Rocksteady sowie die erste populäre Nennung in einem Song von Toots & The Maytals.
Do The Reggay erschien 1969 und brachte bereits alle Zutaten mit, die den Sound für Jahrzehnte prägen sollten. Reggae ging die Dinge ruhiger an als die frenetischen Ska-Rhythmen und ließ die grellen Bläser weg. Stattdessen traten Gitarre und gelegentlich auch Orgeln in den Vordergrund. Der Gospel-inspirierte Sound von Toots & The Maytals wird Marley auch an die Songs erinnert haben, die ihm seine Mutter als Kind vorgesungen hatte. Er jedenfalls war absolut begeistert vom Reggae und ging schon bald mit den Wailers und dem Produzenten Leslie Kong ins Studio, um seine neue musikalische Vision dort umzusetzen.
5. Eric Clapton – I Shot The Sheriff
Das Wort „Reggae“ wird in Europa und den USA auch gerne mal als Sammelbegriff für sämtliche jamaikanische Musik verwendet und selbst gefuchste Musiknerds wären vermutlich aufgeschmissen, wenn sie spontan den Unterschied zwischen Calypso und Mento erklären sollten. Nein, Reggae hat es nach wie vor nicht leicht und auch der internationale Siegeszug des Genres dank Marley selbst musste hart erkämpft werden.
Auf seinem Weg kam Marley von unerwarteter Seite Hilfe zu. Was fand so ein bleicher Brite wie Eric Clapton bitte am Reggae-Sound? Vielleicht mochte die „Slowhand“ ja den entspannten Grundton des Genres. So oder so markiert seine Coverversion von I Shot The Sheriff einen Schlüsselmoment in der Geschichte des Genres und somit der Karriere Marleys: Clapton eröffnete beiden ein völlig neues Publikum, das danach vermehrt zum Original griff. Es scheint ganz so, als hätte Marleys friedliebende Message ihm ein paar Karmapunkte eingespielt.
6. The Impressions featuring Curtis Mayfield – People Get Ready
Nach der Auflösung der Wailers im Jahr 1974 war Marley an einem Scheidepunkt angekommen. Der irrsinnige Erfolg des Clapton-Covers schien eine Fügung des Schicksals zu sein: Marley zog nach England. Dort nahm er die Alben Exodus und Kaya auf, die ihm ganze vier Hits bescherten. Der vielleicht nachhaltig bekannteste davon ist sicherlich One Love. Den Song hatten die Wailers bereits 1965 aufgenommen und dabei glatt unterschlagen, wer große Teile des Songs ursprünglich geschrieben hatte: Curtis Mayfield, Mastermind der Band The Impressions.
One Love ist nicht das einzige Stück, das sich die Wailers bei den Impressions geliehen hatten. Dass die Wailers sich bei der in fünfziger und sechziger Jahren extrem erfolgreichen Vokalgruppe bedienten, lag auf der Hand. Einerseits vereinte die Band den Sound von Gruppen wie den Drifters mit sanften Ryhthm and Blues-Grooves, wie sie dem Ska nahe standen. Andererseits gehörte Mayfield der schwarzen Bürgerrechtsbewegung an und legte somit eine ganz ähnliche Einstellung an den Tag wie Marley und seine Kollegen. Immerhin übrigens holte Marley sein Versäumnis später nach: Die Version auf Exodus nennt Mayfield als Co-Songwriter.
7. James Brown – Say It Loud – I’m Black and I’m Proud
Mayfield wurde nach dem Ende der Impressions als einer der Pioniere des neuen Soul-Genres als Solo-Künstler weltweit bekannt. Nicht nur sein Einfluss aber reichte bis nach Jamaika, auch der „Soul Brother No. 1“ James Brown war bei den Wailers beliebt, wie auch ihren frühen Aufnahmen anzuhören ist. „Oh, das ist, was wir damals alle gehört haben“, sagte Marleys Witwe Rita in einem Interview.
„Es war unser täglich Brot in dem Sinne als dass wir dachten, dass wir eines Tages in allen diesen Radiostationen gespielt würden und glaubten, dass unsere Musik eines Tages in Amerika gespielt würde. Das war in den frühen Sechzigern unser Traum. Bob Marley und die Wailers hörten Curtis Mayfield und die Impressions, und James Brown. Jede Nacht hörten sie sich diese Typen an und versuchten, genauso zu klingen.“ Mehr noch war Brown wie Mayfield auch eine wichtige politische Bezugsperson. Im Song Black Progress zitiert Marley nicht ohne Grund die ikonische Zeile „We rather die on our feet than keep livin’ on our knees“ aus dessen Say It Loud – I’m Black And I’m Proud.
8. Miles Davis – Blue In Green
Obwohl sich Marley überwiegend mit dezidiert schwarzen Musikstilen auseinandersetzte, machte sein Wirken auch nicht vor weißen Musikern Halt. „Bob Marley war der Angelpunkt meines Interesses für schwarze amerikanische Musik und Jazz“, gab etwa Sting zu Protokoll. Jazz ist ein gutes Stichwort, denn auch für das Genre interessiert sich Marley nachhaltig. Dabei ging es ihm nicht nur um den beschwingten Big Band-Sound früherer Zeiten, sondern auch zeitgenössische Interpretationen des traditionsreichen Genres.
So richtig leicht fiel es dem Jamaikaner aber keinesfalls, sich mit Jazz anzufreunden. „Ich konnte es einfach nicht verstehen“, schmunzelte er in einem Interview. „Nach einer Weile aber kapierte ich, worum es ging und ließ mir von Joe Higgs und Seeco Patterson einiges beibringen. Ich habe Ganja geraucht und dann begriff ich Jazz. Ich habe versucht, mich in eine Stimmung zu versetzen, in welcher der Mond blau schimmert, und wollte die Gefühle nachvollziehen, die in Jazz ihren Ausdruck finden.“ Ob dabei auch Miles Davis auf dem Plattenteller rotierte? Ein Song wie Blue In Green scheint allein dem Titel nach schließlich perfekt für eine melancholische Räuchersession auf der heimischen Couch geeignet…
9. Mulatu Astatke – Yèkèrmo Sèw
Im Laufe seiner Karriere setzte sich Marley auch zunehmend mit der Musik des afrikanischen Kontinents auseinander, den er selbst als Wiege der Menschheit betrachtete. Sein Sehnsuchtsland war Äthiopien, wo Mulatu Astatke in den siebziger Jahren den sogenannten Ethio-Jazz etablierte. Astatke hatte in Großbritannien und den USA studiert und dort auch sein musikalisches Handwerk gelernt, schuf aber einen ganz eigenen Sound, der die Klänge seines Heimatlands miteinbezog.
Für einen Rastafari wie Marley hatte Äthiopien einen besonderen Stellenwert: In seinem Glauben handelt es sich dabei um das Heilige Land. 1978 besuchte er es erstmals in seinem Leben, zu einer Zeit also, als Astatke gerade mit dem Ethio-Jazz einen neuen Sound schmiedete, der nicht unähnlich dem Reggae der schwarzen Diaspora eine Stimme verlieh. Die Alltagsrealität im Heiligen Land sah aber düsterer aus, als die wortlose Musik Astatke klang: Ein Bürgerkrieg tobte, als Marley dort die Rastafari-Community im Städtchen Shashemene besuchte. Es hat seiner Faszination keinen Abbruch getan und 2005 orderte seine Witwe sogar eine Umbettung seiner leiblichen Überreste nach Äthiopien an.
10. Lee “Scratch” Perry & The Upsetters – Enter The Dragon
Marley starb jung und doch ist sein Erbe größer als das mancher anderer Stars seiner Zeit. Obwohl er auf immer das Gesicht des Reggae-Sounds bleiben wird, so waren seine Einflüsse doch ebenso vielseitig wie sein eigenes Schaffen. Als Reggae-Pionier hat er auch an der Entstehung von anderen Sounds seinen Anteil gehabt. Als Produzenten wie King Tubby und Lee „Scratch“ Perry den Sound des Genres im Studio auf seine Bass- und Rhythmuselemente eindampften und somit den Dub schufen, war Marley live dabei.
Dub revolutionierte die Musikgeschichte, indem es noch vor den großen Krautrock-Produzenten wie Conny Plank das Studio zum eigentlichen Instrument erhob. Dub-Musik war explizit für die Benutzung auf den mobile Soundsystemen in Jamaika gedacht, wo die Platten für ein tanzwilliges Publikum aufgelegt wurden. Mit Lee „Scratch“ Perry und seiner Band Upsetters hatte Marley selbst für eine kurze Zeit zusammengearbeitet und blieb ihm bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden. Gemeinsam nahmen sie in Perrys legendärem Black Ark-Studio im Jahr 1978 ein paar Demos auf, zu denen Perry auch eigens ein paar Dub-Versionen bastelte. Zwei musikalische Visionen, harmonisch miteinander vereint.
Das könnte dir auch gefallen:
10 Songs, die jeder Bob Marley Fan kennen muss
‘Exodus’: Wie Bob Marley eine Schießerei überlebte und seinen größten Erfolg feierte