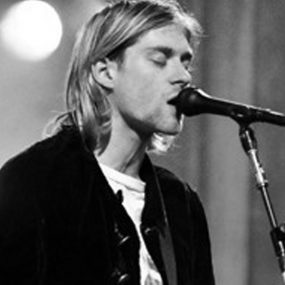Popkultur
Gitarrengott: Muddy Waters

Wie die meisten großen Elektro-Blues-Musiker der Nachkriegszeit stammte der Bandleader, Songwriter, Gitarrist, Sänger, Interpret und Haupt-Impulsgeber der Elektro-Blues-Szene in Chicago ursprünglich aus dem Mississippi-Delta. Muddy Waters war nicht nur ein bedeutender Musiker, sondern auch ein großzügiger Mensch, der zahlreiche jüngere oder weniger erfolgreiche Kollegen förderte, wie diese später bezeugten. Vor allem aber ist und bleibt er der unangefochtene König des Chicago Blues.
„Nein, ich bin kein Millionär, aber ich hatte viele Manager, die zu Millionären wurden.“ – Muddy Waters
Seinen Spitznamen Muddy Waters (wörtlich: „Schlammige Gewässer“) soll ihm die Großmutter nach dem Bach verpasst haben, in dem er als Kind gerne spielte. Unter diesem Namen hat er weit über die Grenzen des Blues hinaus Musikgeschichte geschrieben. Mit seiner Behauptung „Der Blues bekam ein Baby; sie nannten es Rock’n’Roll“ hatte er zweifellos recht, und unter den jungen weißen Möchtegern-Blues-Musikern genoss er ein so hohes Ansehen wie kein Zweiter. Jene junge britische Band, die später als „größte Rock’n’Roll-Band der Welt“ Weltruhm erlangen sollte, benannte sich 1962 nach einem Song, der auf dem Album The Best of Muddy Waters (1958) veröffentlicht wurde.
Digging deeper…
McKinley Morganfield verlor seine Mutter im Alter von ungefähr drei Jahren und zog zur Großmutter auf die Stovall-Plantage. Als Erwachsener arbeitete er zunächst dort als Landarbeiter und lernte zunächst Mundharmonika und später auch Gitarre zu spielen. Seine ersten Auftritte hatte er ab etwa 1935 in afro-amerikanischen Kneipen, den sogenannten Juke Joints, bei Partys und Tanzveranstaltungen in der Umgebung von Clarksdale.
Im Sommer 1941 nahm der Folklore- und Musikforscher Alan Lomax Muddy Waters im Rahmen seines Forschungsprojekts für die Library of Congress auf der Stovall-Farm mit den Stücken Country Blues und Burr Clover Country Blues auf. Howard Stovall, dessen Familie die Farm bis heute gehört, erzählte: „Er war zuständig für den Burr Clover, den Geknäulten Klee, eine Zwischenfrucht, die gesät wurde, um den Boden mit Stickstoff anzureichern. Das ist echte Plackerei, man muss es mit der Hand harken und in Säcke füllen und dann die Samen auf dem Feld verteilen, um die Bodenfruchtbarkeit für die nächste Ernte zu verbessern. Ich hatte die Ehre, das mal einen Sommer lang zu machen, und Muddy war davon offenbar ähnlich begeistert wie ich, er konnte es nur wortgewandter zum Ausdruck bringen.“
Schaut euch hier eine Live Version von Muddy Waters Hoochie Coochi Man an:
1943 zog es Waters gen Norden; wie viele andere vor ihm nahm er den Zug nach Chicago, wo er zunächst in einer Papierfabrik Arbeit fand. Bald nach seiner Ankunft in der Stadt begann er für Trinkgelder auf der Maxwell Street zu spielen; mit Unterstützung von Big Bill Broonzy gelang es dem Landjungen, die Großstadt zu erobern. Er spielte in Clubs, stand mit Eddie Boyd auf der Bühne und begleitete Sonny Boy Williamson bei Auftritten im Plantation Club. Der Wechsel von der Akustik- zur E-Gitarre im Jahr 1944 erwies sich als absoluter Glücksgriff. Er spielte auch weiterhin im traditionellen Bottleneck-Stil des Mississippi-Deltas, doch die E-Gitarre erschloss ihm neue Klangwelten und trug entscheidend zur „Erfindung“ des Chicago Blues der Nachkriegszeit bei. Die Aufnahmen, die er 1946 mit der Chicago-Blues-Koryphäe Lester Melrose einspielte, blieben unveröffentlicht. Erst im folgenden Jahr war Waters als Begleitgitarrist für Sunnyland Slim erstmals auf einer Platte zu hören.
Waters und der Bassist Big Crawford nutzten die Gelegenheit, um zwei weitere Stücke aufzunehmen, die Leonard Chess jedoch nicht genügend überzeugten, um sie zu veröffentlichen. Ein Jahr versuchten die beiden Musiker es noch einmal, und Chess’ Label Checker brachte I Can’t Be Satisfied und Feel Like Going Home heraus. Bei ersterer Nummer handelte es sich um eine geänderte Version von I Be’s Troubled, einem Stück, das Waters 1941 für Lomax aufnahm und oft bei Live-Auftritten spielte. Feel Like Going Home war eine umgearbeitete Version des Walking Blues von Son House, einem Musiker, den Waters ungemein schätzte – auch dies eine Nummer, die Waters vor dieser Aufnahme wohl schon unzählige Male gespielt hatte. Die Platte war innerhalb eines einzigen Tages ausverkauft und stieg im September 1948 auf den 11. Platz der R&B-Charts auf; Waters erinnerte sich später, dass er sogar selber Schwierigkeiten hatte, ein Exemplar zu ergattern. Obwohl Waters mittlerweile eine eigene Band hatte, hielt Chess an dem einmal bewährten Erfolgsrezept fest und bestand darauf, dass Waters und Big Crawford auch bei weiteren Aufnahmen als Duo oder mit dem Gitarristen Leroy Foster spielten.
Ende der 40er Jahre bestand Waters‘ Band aus Leroy Foster an der Gitarre oder am Schlagzeug, Big Crawford an der Bassgitarre, Jimmy Rogers an der Gitarre oder Mundharmonika, bald darauf kam Little Walter Jacobs als Gastmusiker auf der Mundharmonika hinzu. Schon mit Anfang dreißig galt Waters als Patriarch der Blues-Szene in Chicago. In den fünfziger Jahren rissen sich die besten Musiker der Stadt geradezu darum, in seiner Band spielen zu dürfen. 1951 erschien die erste Plattenaufnahme der Muddy Waters Blues Band, die den kantigen, treibenden Elektro-Blues aus Chicago als Fundament dessen, was wir heute als Rock-Musik bezeichnen, aufs Schönste verkörperte.
1951 bescherte „Louisiana Blues“ Waters den zweiten von insgesamt sechzehn Chart-Hits in Folge, darunter Klassiker wie I’m Your Hoochie Coochie Man, Just Make Love to Me, Mannish Boy oder Forty Days and Nights. Daneben nahm der Mann aus Rolling Fork/Mississippi Rollin’ and Tumblin, Rollin’ Stone und They Call Me Muddy Waters auf. Wenn er sich in letzterem Song selber als „the most bluest man in this whole Chicago town“ bezeichnet, gibt es wohl kaum jemanden, der ihm widersprechen würde. In jeder einzelnen dieser Aufnahmen kommt die eigentliche Essenz des Chicago Blues der 50er zum Ausdruck.
Unter dem Titel Muddy Sings Big Bill erschien 1959 Waters‘ Tribut an seinen einstigen Mentor, der ein Jahr zuvor verstorben war. Dass der Mann, den Waters als „Vater der Country-Blues-Sänger“ verehrte, ihn als jungen Mann unter seine Fittiche nahm, dürfte zu den wichtigsten Erfahrungen in Waters‘ Leben gezählt haben. Zudem werden auch die Ähnlichkeiten im Gesangsstil der beiden Musiker deutlich. Auf dem Album wird Waters von seiner damaligen Band begleitet, mit James Cotton an der Mundharmonika, Pat Hare an der Gitarre und dem großartigen Otis Spann am Klavier. Ihre Version von „Just a Dream“ ist ein Zeugnis der Seelenverwandtschaft zwischen zwei großen Musikern – obzwar Waters sich den Song auf souveräne Weise zu Eigen macht, klingt der Einfluss seines Mentors und Vorbilds doch unüberhörbar durch.
Während der gesamten fünfziger bis Anfang der sechziger Jahre fungierte Waters‘ Band als wichtigste Studioband der Stadt als eine Art Blues-Akademie für aufsteigende Nachwuchstalente. Zu denen, die diese Schulung durchliefen, zählten u.a. die Gitarristen Jimmy Rogers, Luther Tucker und Earl Hooker; die Mundharmonikaspieler Junior Wells, Big Walter Horton und James Cotton, der Bassist Willie Dixon; die Klavierspieler Memphis Slim, Otis Spann und Pinetop Perkins sowie der Schlagzeuger Fred Below. Nicht zu vergessen Buddy Guy, der auf Waters‘ unverzichtbarem Album von 1964, Muddy Waters Folk Singer, spielte – ein weiterer Musiker, der Waters eine Menge zu verdanken hatte.
Schaut euch hier eine Live Version von Muddy Waters & The Rollings Stones mit dem Song Baby Please Don’t Go an:
„Nach dem Schlaganfall meiner Mutter verließ ich am 25. September 1957 Baton Rouge/Louisiana und ging nach Chicago. Eigentlich suchte ich bloß einen ganz normalen Job, um meiner Mutter zu helfen, geriet aber in eine missliche Lage. Ich konnte keine Arbeit finden, niemand wollte mich einstellen. Erst spielte ich auf der Straße, und eines Tages packte mich dieser Typ und schleifte mich in einen Club. Dort spielte Otis, und der Typ sagte ihm, er solle mich auf die Bühne holen. Ich spielte ‚Things I Used to Do‘, und jemand rief Muddy an. Ich war ziemlich hungrig, denn ich hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Muddy kam rein und schlug mir auf die Schulter und sagte, Wart mal, ich hab von dir gehört, die haben mich angerufen und aus dem Bett geholt. Er sagte, Haste Hunger, ich sagte, Du bist Muddy Waters, ich hab keinen Hunger, ich bin satt, weil ich dich kennenlernen durfte.“
Wie viele zeitgenössische Musiker tourte Waters in den 60ern im Rahmen der American Folk Blues Festivals durch Großbritannien, wo er auf weitaus bessere Resonanz stieß als bei seinem vorherigen Besuch im Jahr 1958, damals auf Einladung des Jazz-Posaunisten Chris Barber. In den 50ern wurde die Blues-Flamme auf der Insel vor allem von Jazz-Liebhabern am Leben gehalten, die sich darüber empörten, dass Waters mit Verstärker spielte – ihrer Überzeugung nach musste der Blues akustisch gespielt werden, um authentisch zu sein. Glücklicherweise hatten sich die Zeiten mittlerweile geändert. Im Mai 1964 nahm Otis Spann in den Londoner Decca-Studios mit dem Produzenten Mike Vernon eine Single auf. Bei den Stücken Pretty Girls Everywhere und Stirs Me Up wurde Spann von Waters als Rhythmus- und Eric Clapton als Lead-Gitarristen begleitet. Letzterer erinnerte sich Jahre später, dass „sie beide sehr nett zu mir waren und wunderschöne seidene Anzüge trugen, mit sehr weiten Hosen!“
Nachdem in den späten 60ern sowohl die Beliebtheit der Blues-Musik als auch Waters‘ Laufbahn einen Einbruch erlitt, war er in den 70ern wieder sehr gefragt und praktisch ständig auf Tournee. 1977 nahm ihn CBS Records unter Vertrag. Für das in Zusammenarbeit mit Johnny Winter entstandene Album Hard Again wurde er im gleichen Jahr mit einem Grammy ausgezeichnet. Ein weiteres Album folgte unter dem Titel I’m Ready, und im Rahmen seiner US-Tournee trat Waters auf Wunsch des neuen Präsidenten Jimmy Carter sogar im Weißen Haus auf.
In den frühen 80ern spielte Waters noch live mit Johnny Winter. 1983 verstarb er mit 68 Jahren an einem Herzinfarkt. Mit der Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 1987 wurde ein Musiker geehrt, der die Entwicklung der Rockmusik entscheidend mitgestaltet hatte und die Wertschätzung ihrer weltweiten Fangemeinde genoss.
Das könnte dich auch interessieren: