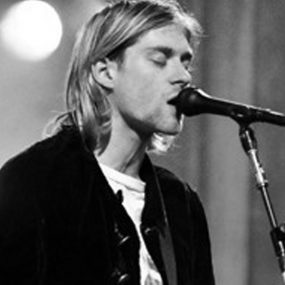Popkultur
Die musikalische DNA von The Police

„Keine Zukunft!“, lautete der Schlachtruf der Punk-Generation und ironischer Weise leitete genau das eine neue Zeitrechnung der Pop- und Rock-Musik ein. Alles wurde auf null gesetzt, alles war erlaubt und die Grenzen waren wieder zum Überschreiten gedacht. Als Post-Punk oder auch New Wave wurde die Musik bezeichnet, die aus dem Geiste von Punk etwas gänzlich Neues schaffte. Wie das Gros der Bands, die in dieser Zeit federführend wurden, kamen auch The Police aus Großbritannien. Sie hatten die Punk-Revolution miterlebt, konnten aber auch mit einer soliden Grundausbildung in Sachen Blues Rock, Soul und sogar Jazz aufwarten. Selbst vor Reggae, der mit der sogenannten „Windrush generation“ seinen Weg von Jamaika nach England gefunden hatte, stand bei ihnen auf dem Programm.
Hört hier in die musikalische DNA von The Police rein:
Für die ganze Playlist klickt auf „Listen“.
Das sind ganz schön viele Einflüsse für eine Band, die für die meiste Zeit aus lediglich drei Mitgliedern bestand: Bassist und Sänger Sting, Stewart Copeland und Andy Summers, der bereits im August 1977 den ursprünglichen Gitarristen Henri Padovani ersetzt hatte. Ganz schön groß waren auch die Erfolge der Band, die zwischen 1978 und 1981 fünf Alben veröffentlichten. Schon mit Roxanne von ihrem Debüt Outlandos d’Amour lieferten sie einen ikonischen Crossover-Hit ab, der Reggae mit Punk und viel Pop-Appeal zusammenbrachte. Das schmeckte dem Underground nicht wirklich, aber The Police scherten sich wenig drum. Was sie vor allem auseinander trieb, waren interne künstlerische und persönliche Differenzen sowie Probleme im Privatleben. Einen gebührenden Abschluss für ihre Karriere legten sie dann mit einer großen Tour von 2007 bis 2008 hin. Ob‘s das wirklich für immer gewesen war? Wer weiß.
Was wir mit Sicherheit sagen können: The Police gehörten zu den wenigen Bands, die Rock-Musik nach den siebziger Jahren unbeschadet ins nächste Jahrzehnt hinüberretten konnten. Welche Klänge sie bei dieser Mammutaufgabe beeinflussten, erfahren wir mit Blick auf ihre musikalische DNA.
1. Jimi Hendrix – Gypsy Eyes
Wie weit wir ausholen müssen, um die Inspiration von The Police einzukreisen, das zeigt schon ihre Gründung an. Im November 1976 traf Steward Copeland auf den ehemaligen Lehrer Gordon Sumner, den all wegen seines schwarz-gelben Bienenlooks nur „Sting“ nannten. Der US-Amerikaner Copeland war der Sohn eines CIA-Agenten und einer Archäologin hätte wohl eigentlich der nächste Indiana Jones sein sollen. Doch er entschied sich mit zwölf Jahren, dafür, auf dem Schlagzeugschemel Platz zu nehmen. Nachdem seine Familie unter anderem in Kairo und Beirut gelebt hatte, fand er in England sein Zuhause, studierte in Kalifornien und kehrte dann ins UK zurück.
Zuerst als Road Manager und später als Drummer heuerte er bei der Band Curved Air an, die sich nach Terry Rileys Komposition A Rainbow in Curved Air benannt hatte. Die von indischer Musik beeinflusste Minimal Music Rileys sowie die klassischen Rhythmen aus unter anderem dem Libanon sowie zuletzt der in Großbritannien sich entfaltende Prog Rock – all das inspirierte Copeland nachhaltig. „Als ich aber noch ein Baby-Drummer war und Drum-Soli hören wollte“, erinnerte er sich, „waren das Sandy Nelson, Ginger Baker und Mitch Mitchell.“ Baker und Mitchell brachten ihm wohl auch bei, wie sich hinterm Kit ein Trio zusammen halten ließ: Mitchell etwa nahm gemeinsam mit Jimi Hendrix und Noel Redding das Electric Ladyland-Album auf. Vom Song Gypsy Eyes angeblich sogar 50 verschiedene Takes…
2. Cream – Sunshine of Your Love
Ginger Baker war Teil einer anderen Band, die für die Entwicklung von The Police nicht minder wichtig war – und nebenbei noch bewies, dass ein Trio bestens funktionieren kann. Eric Clapton, Jack Bruce und Baker bildeten Cream, die Supergroup der Blues Rock-Szene Englands und nebenbei die vielleicht zu dieser Zeit lauteste Band der Welt. Sting war schon seit Schulzeiten ein Fan Claptons, der etwas ältere Gitarrist Summers allerdings kannte sowohl Hendrix als auch die „Slowhand“ noch viel länger. „Ich hab ihm seine erste Les Paul verkauft, mit der er Fresh Cream aufnahm“, verriet er in einem Interview.
Trotzdem spielte sich Summers nie als Mentor des kongenialen Gitarristen auf, der wie The Police – allerdings viel später – Reggae für sich entdeckte und massentauglich machte. Vielmehr zollte Summers der Band Cream durchaus den Respekt, den diese verdient hatten. Wusstet ihr, dass The Police bei ihrer Synchronicity-Tour im Jahr 1984 bei Soundchecks gerne mal Klassiker der sechziger Jahre wie The Kinks‘ You Really Got Me oder eben Creams Sunshine of Your Love spielten, um sich aufzuwärmen? Inklusive messerscharfer Gitarrenlicks natürlich. Summers hat Clapton vielleicht sein Arbeitsgerät verkauft, das Handwerk aber hat er sich von ihm ebenso geliehen…
3. Agustín Barrios – Cordoba
Summers war zehn Jahre älter als Copeland und Summers, als sie zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne standen und brachte dementsprechend nicht nur ein paar gute Anekdoten, sondern auch einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit. Das Gong-Mitglied Mike Howlett hatte zuerst Sting dazu eingeladen, ihm bei Strontium 90 Gesellschaft zu leisten und holte Copeland mit an Bord, nachdem ihm Schlagzeuger Chris Cutler abgesagt hatte. Summers komplettierte die Band, deren Demos erst in den neunziger Jahren unter dem Titel Strontium 90: Police Academy erschienen – was ein Kalauer!
Seine Qualitäten als Gitarrist hatte Summers vor allem mit Eric Burdon und dessen Bands The Animals unter Beweis gestellt. Das Cover von Traffics Coloured Rain auf dem Animals-Album Love Is enthält ein gar 4 ½-minütiges Gitarrensolo des damals 26-jährigen Gitarristen – der zu dieser Zeit allerdings schon ein gutes Jahrzehnt im Geschäft war. Der Wahnsinn! Das Wissen, das Summers in seine Bands mit einbrachte, war aber auch ein klassisches und erstreckte sich nicht auf Rock-Musik allein. Als einen seiner großen Helden nannte er zum Beispiel Agustín Barrios, einen paraguayischen Gitarrenvirtuoso, der zwischen 1885 und 1944 lebte.
4. The Clash – London‘s Burning
Von Copeland vielfältigen Einflüssen hin zu Summers klassischer Ausbildung in allen Bereichen der Saitenkunst und natürlich Stings bestens dokumentiertem Faible für Jazz tut sich in den Einflüssen von The Police eine ungemeine Virtuosität auf, die zuerst verblüfft. Denn warum ist die Musik dieser drei Typen so verdammt einfach, wenn sie bisweilen so komplexe Musik hören? Die Antwort findet sich im Gründungsdatum der Gruppe. 1977 steht Punk auf dem Zenit. Bands wie die schon wieder im Verglühen begriffenen Sex Pistols sowie The Clash bewiesen: Auch das Einfache kann eine ungemeine Wirkung haben.
The Police mussten sich selbst am Anfang ihrer Karriere oft anhören, dass sie Poser seien. Der Musikjournalist Christopher Gable schrieb etwa: „Die Wahrheit ist, dass die Band sich lediglich mit den Klischees des britischer Siebziger-Punks schmückte. […] Tatsächlich wurden sie von anderen Punk-Bands dafür kritisiert, nicht authentisch zu sein und keine ‚Street Cred‘ zu haben.“ Die Wahrheit war indes, dass sich The Police nicht sonderlich viel um ihre Street Cred kümmerten. Sie hatten Größeres vor. Aus der Punk-Szene holten sie sich allerdings durchaus Inspiration, insbesondere von The Clash. Die nämlich machten schon vor ihnen vor, dass Punk erstaunlich gut mit Reggae harmonieren konnte. Schon auf dem Debütalbum The Clash deutete sich das rhythmisch in Songs wie London’s Burning an.
5. The Who – My Generation
Der minimalistische Ansatz von Punk – „hier ist ein Akkord, dort ein zweiter und hier ein dritter, jetzt gründ‘ ‘ne Band“, frotzelte 1977 ein Karikaturist im US-amerikanischen Fanzine Sideburns (und nicht, wie häufig fälschlich behauptet, in Sniffin‘ Glue) – hatte auf beiden Seiten des Atlantiks seine Vorreiter. The Stooges etwa in den USA oder sogar MC5 oder The Velvet Underground werden als Pioniere genannt. In Großbritannien aber orientierten sich viele Bands an dem, was The Who einst mit Hits wie My Generation aus dem Jahr 1965 losgetreten hatten. Das ging auch an der ansonsten transatlantisch aufgestellten jungen Band nicht vorbei.
Vor allem für ein Mitglied wurden The Who wichtig. Sting debütierte 1979 als Schauspieler in der Rock-Oper Quadrophenia von The Who als Ace Face und legte eine denkwürdige Leistung hin. Der Beginn einer lukrativen Zweitkarriere, die sich negativ auf das Schaffen seiner Band auswirken sollte. Denn als Hauptsongwriter und Sänger stand er schon auf der Bühne ganz vorne, nun allerdings konnte er auch noch anderswo punkten – während seine Kollegen weitgehend in die Röhre schauten. Buchstäblich gesprochen natürlich, denn ab den frühen Achtzigern verbrachte Sting bisweilen mehr Zeit auf der Leinwand als im Studio… Nicht jeder Einfluss ist für die Gesamtheit einer Band ein positiver.
6. Eberhard Schoener – Why Don’t You Answer
Doch wusstet ihr auch, dass sich The Police schon früh und quasi nebenbei einem deutschen Publikum empfahlen? Allgemein wissen bis auf echte Police-Fans nur wenige, dass Sting und Summers sowie zeitweise auch Copeland ab Ende 1977 mit dem Komponisten Eberhard Schoener aus der Kraut- und Art Rock-Szene kollaborierten. Drei Alben kamen dabei zustande, die bisweilen in Richtung Fusion Jazz und Electronica vorstießen. Tracks wie Why Don’t You Answer vom 1978 erschienenen Album Flashback beispielsweise erinnern deutlich an das Schaffen von Bands wie Kraftwerk. Durch Live-Auftritte wurde das Publikum hierzulande mit Stings ungewöhnlicher Stimme vertraut.
Sting erinnerte sich: „Andy brachte Stewart Copeland und mich 1977 nach München, um dort mit dem ungewöhnlichen Dirigenten zusammenzuarbeiten. Wir hatten erst vor Kurzem The Police gegründet und brauchten dringend Geld, um unsere verwegenen Träume vom Ruhm aufrechtzuerhalten.“ Nicht allein die gute Bezahlung, sondern auch das ambitionierte Rundumkonzept Schoeners lockte die Band. Summers beschrieb es als „Multimedia-Komposition aus Laser, Zirkus, Rock, klassischer und elektronischer Musik mit Balletttänzern und einem Pantomimen“. Ein gutes Training für die späteren The Police, deren Bühnenperformances sich immer größeren Konzertsälen anpassen mussten.
7. Thelonious Monk – ‚Round Midnight
Was The Police im Kern ausmacht, ging immer schon über die Musik von The Police hinaus. Als Sting seine erste Solo-LP The Dream of the Blue Turtles im Jahr 1985 veröffentlichte, überraschte das Eingeweihte keinesfalls: Er war eben im Herzen auch ein Jazzer, was sich auf den Sound der Platte niederschlug. Copeland derweil nahm einen Film auf, Summers ging mit dem Experimentalmusiker Robert Fripp ins Studio. Auch nach der Trennung von The Police fanden sie so immer wieder für ungewöhnliche Projekte zusammen, darunter beispielsweise für Summers‘ Version des Jazz-Klassikers ‘Round Midnight, auf dem auch Sting als Sänger zu hören war.
Das Cover war als Huldigung des genialen und mehr als kauzigen Pianisten Thelonious Monk gedacht und erschien auf Summers‘ LP Green Chimneys im Jahr 1999, einer Sammlung von Monk-Interpretationen. Ebenso wie der Bassist Sting und der Drummer Copeland hatte eben auch der Gitarrist der Band ein besonderes Faible für den Jazz. Das erklärt letztlich auch, was The Police von vielen Rock-Gruppen ihrer Zeit unterschied: Aus dem Jazz hatten sie gelernt, dass eine Band mehr als nur die Summe ihre Einzelteile (oder gar: Egos!) sein musste. Nicht, dass es nicht trotzdem zu Zerwürfnissen gekommen wäre. Aber auf der Bühne ging alles fein säuberlich ineinander über…
8. Bob Marley & The Wailers – Exodus
…was neben den einzelnen Instrumenten und Stimmen auch verschiedene Genres mit einschloss. The Police wurden vor allem für den Reggae-Einfluss in ihrer Musik berühmt und obwohl das auf den ersten Blick verblüffen mag, so hat es doch seine geschichtlichen Gründe. Nicht alle von ihnen sind schön – der britische Kolonialismus steht schließlich an ihrem Anfang. Für Sting bedeuteten die Migrationsbewegungen nach England allerdings, dass er mit Stilen wie Calypso und Ska oder Plattenlabels wie Bluebeat aufwuchs. Eine Person sollte ihn besonders prägen: „Als Bob Marley nach England kam, war das revolutionär. Er hat Rock auf den Kopf gestellt, angefangen von der Wichtigkeit des Bass hin zu den Drums, die ganz anders gespielt werden.“ Nicht zuletzt fühlte sich der stets auch sozialpolitisch aktive Sting von Marleys Engagement abseits der Bühne inspiriert.
Nicht allen gefiel aber, wie The Police den Reggae-Einfluss in ihrer Musik spiegelten. Der Rolling Stone-Autor Tom Carson beispielsweise nannte ihr Debüt damals „wirklich widerlich in dem Minstrel-Show-Natty-Dread-Akzent, den Sting für die Reggae-Nummern aufsetzt.“ Minstrel-Shows waren bekanntlich im 19. Jahrhunderts rassistische Aufführungen, bei denen sich weiße Musiker das Gesicht bemalten und Schwarze imitierten, Natty Dread ist einerseits das Album eines Bob Marley-Albums, bezeichnet aber vor allem ein Mitglied der Rastafari-Gemeinschaft. Ein harter Vorwurf, auf den die Band zuerst mit Albumtitel Reggatta de Blanc – eine Verballhornung von „weißer Reggae“ – reagierte. Heute ist Sting etwas kleinlauter und spricht davon, dass er seine Musik immer als Hommage verstanden hat.
9. Grace Jones – Demolition Man
Tatsächlich scheint seine Band aber durchaus hin und wieder etwas größenwahnsinnig gewesen zu sein, wenn es um den Umgang mit Ausgangsmaterial anderer ging. Als Grace Jones ihr Album Nightclubbing und den darauf enthaltenen, deutlich von Reggae und Punk inspirierten Song Demolition Man veröffentlichte, wollten sie sofort eins draufsetzen und legten ihre eigene Version nur wenige Monate später auf dem Album Ghost in the Machine nach. Lässt sich das noch als Hommage entschuldigen? Nun ja: Geschrieben hatte das Stück doch ein Police-Mitglied…
…nämlich Sting! Der besuchte zu dieser Zeit seinen Kumpel Peter O‘Toole in Irland, wo dieser mit seiner damaligen Freundin Trudie Styler lebte. Genau, dieselbe Styler, die Sting ein gutes Jahrzehnt später heiratete. Keine Frage also, wer der Demolition Man in diesem Dreieck war! Aber Spaß beiseite, tatsächlich wollten The Police mit ihrer Version ihr Revier markieren. „Grace Jones hatte ihn zuerst aufgenommen, aber wir nahmen daran Anstoß, dass jemand anderes einen Hit damit hatte“, gab Sting in einem Interview zu. Die jazz-funkige Version seiner Band konnte dem Jones-Stück in Sachen Erfolg jedoch kaum das Wasser reichen. Wie ironisch!
10. Puffy Daddy – I’ll Be Missing You (feat. Faith Evans & 112)
Genauso ironisch wie „die größte Abzocke aller Zeiten“, wie Summers es einmal wutschäumend nannte. Worum es geht? Natürlich um I’ll Be Missing You von Puff Daddy und Faith Evans & 112, in dem der Rapper seinem Freund Notorious B.I.G. Lebewohl sagt und zwar auf Summers‘ ikonischer Gitarrenmelodie aus Every Breath You Take. Das Lick komplettierte eine bis dahin noch unvollständige Komposition Stings, inspiriert übrigens ist es von der Musik des ungarischen Komponisten Béla Bartók. Gesampelt wurde es ohne Erlaubnis. „Mein Sohn, der zu der Zeit zehn Jahre alt war, sagte mir: ‚Hey Dad, da spielt irgendein Mädchen euren Song im Radio! Ich kam in sein Zimmer, hörte dem Radio zu und stotterte nur: ‚Das bin ich, aber was zur Hölle ist das?‘“
Eben: Die größte Abzocke aller Zeiten: Da Every Breath You take von Sting geschrieben wurde, gehören ihm die Rechte daran und weil Puff Daddy das Sample ohne Genehmigung verwendete und Sting ihn dafür verklagte, bekommt er zusätzlich zu den Erlösen aus dem Original auch die von I’ll Be Missing You zu 100% ausgezahlt. Zwischenzeitlich wurde berichtet, dass Sting somit auf etwa 2000$ pro Tag käme. Summers aber? 0$. Böses Blut gab es deswegen wohl nicht. Als Copeland Summers 2000 in einem Interview dazu aufforderte, sein „Puff Daddy-Geld“ einzufsordern, schmiss Sting ein bisschen Kleingeld auf den Tisch. „Sorry, den Rest habe ich schon ausgegeben.“ Derbe Scherze geben intern wohl den Ton an…
Headerbild Credit: Fin Costello/Redferns/Getty Images
Das könnte euch auch gefallen:
10 Songs, die jeder The Police-Fan kennen muss
The Police – Die 5 größten, bemerkenswertesten und skurrilsten Live-Momente