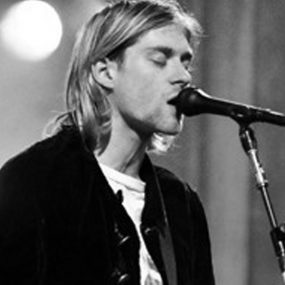Popkultur
Die musikalische DNA von The Verve

Es gab eine Zeit, da waren The Verve nur eine recht unbedeutende Psychedelic-Truppe mit einem ausgeprägten Hang zu harten Drogen. Nur wenig später waren The Verve die beste Band der Welt und hatten gleich dreimal mehr Lust am Exzess. Viel geredet hat die Band um Richard Ashcroft über ihre Musik nie, ihr Sänger dafür aber umso mehr. Für seine Kollegen sprachen die zerstörten Hotelzimmer wohl für sich oder zumindest die Musik, mit der The Verve auch jenseits vom Welterfolg Bittersweet Symphony ihren Status als eine der interessantesten britischen Bands überhaupt untermauern konnten.
Hört euch hier die musikalische DNA von The Verve in einer Playlist an und lest weiter:
Dass The Verve oftmals gemeinsam mit Oasis und Blur in die Brit Pop-Schublade gestopft wurden, war stets eher zweifelhaft. Denn so gut sich die Band mit denen auch verstanden und so eng das Verhältnis zwischen Ashcroft und Noel Gallagher auch heute noch ist: The Verve haben musikalisch immer noch viel mehr geboten als hymnische Refrains und spröden Schrammelrock. Ihre Musik kam aus dem experimentellen Gebiet und überzog den Mainstream mit den schillernden Gitarrentexturen von Nick McCabe.
Was aber macht die musikalische DNA von The Verve aus? Ashcroft beschrieb die Einflüsse der 2009 (vielleicht nicht endgültig?) aufgelösten Bands als „breit und abwechslungsreich“. Funk, klassische Rock-Bands, Hip Hop und Downbeat, Garage Rock oder Miles Davis und sowieso alles irgendwie flossen in den Sound seiner Band ein. „Es ist echt schwer, wenn die Leute uns nach unseren Einflüssen oder unseren Vorlieben fragen“, gab er zu. Versuchen wir trotzdem, die musikalische DNA von The Verve zu entschlüsseln! Vielleicht kommen wir dem einen oder anderen Geheimnis auf die Spur.
1. Stone Roses – I Am The Resurrection
Beginnen wir Ende der achtziger Jahre. England ist ermüdet vom sterilen Synth Pop des grellen Jahrzehnts und wendet sich langsam dem Acid House-Sound zu, der von Chicago aus zuerst in Manchester – pardon: Madchester – ankommt. Die Stone Roses gehören zu den Bands, welche die Faszination an den schnellen Rhythmen und psychedelischen Sounds am subtilsten ins Rock-Format übertragen. Songs wie I Am The Resurrection von ihrem selbstbetitelten Debütalbum leihen sich die großen Erzählbögen der Rave-Kultur und übertragen sie in Musik, die das ekstatische Verlorensein in der Musik zurück in die Konzertsäle bringt. Dort sieht sie 1989 auch Ashcroft. „Die Stone Roses haben mich von Anfang an umgehauen“, gab er im NME zu Protokoll und schwärmte davon, wie im Underground bereits Tapes mit Konzertmitschnitten kursierten, bevor die Band überhaupt eine Platte veröffentlicht hatte. „Textlich wollten sie so viel mehr, als Gitarrenmusik zu dieser Zeit war. Es war komisch, vor der Bühne standen einige wenige Frauen und der Rest waren Lads, richtig harte, aggressive Lads. Dieser Widerspruch hat mich ungemein inspiriert.“ So legten die Stone Roses den Grundstein für eine neue Band, die Ashcroft gemeinsam mit seinen Schulkumpanen Simon Jones und Nick McCabe im Jahr 1990 gründete: The Verve.
2. Oasis – Cast No Shadow
À propos Lads: Die Band, die den ultimativen Typus des jungen, hedonistischen, britischen Mannes verkörperten, waren Oasis. Die ein Jahr nach The Verve gegründete Gruppe um die Gallagher-Brüder Noel und Liam freundete sich schnell mit dem aufstrebenden Quartett an. Als The Verves sphärisch-verschwebtes Debütalbum A Storm In Heaven erschien, spielten die beiden regelmäßig Konzerte miteinander. Oasis waren damals nahezu unbekannt, ein Jahr sollte es noch bis zu ihrem Durchbruch dauern. Dann aber überflügelten sie The Verve und wurden in Sachen Erfolg erst wieder von ihnen eingeholt, als die Band mit ihrem (ersten) Comeback-Album Urban Hymns im Jahr 1997 schlagartig weltberühmt waren. Dem guten Verhältnis zueinander hat das aber nie geschadet, im Gegenteil. Als The Verve mit A Northern Soul einen Richtungswechsel hin zu konventionelleren Rock-Sounds einschlugen, hatte das auch mit Oasis zu tun. Angeblich soll der Titelsong sogar Noel Gallagher gewidmet sein! „Give me your powder and pills / I want to see if they cure my ills / I’ve no time for love and devotion / No time for old fashioned potion”, heißt es darin. Noel konterte kumpelhaft mit Cast No Shadow vom zweiten Oasis-Album (What’s The Story) Morning Glory?: „Bound with all the weight of all the words he tried to say / Chained to all the places that he never wished to stay / Bound with all the weight of all the words he tried to say / And as he faced the sun he cast no shadow“. Ein direkter, aber ebenso zärtlicher Umgangston – echte Lads eben!
3. Andrew Oldham Orchestra – The Last Time
Worauf sich der Erfolg von Urban Hymns gründet, wissen wir alle. So großartig die Vorgängeralben waren, so fantastisch die dritte The Verve-LP als Ganzes ist: Wäre nicht Bittersweet Symphony gewesen, dann wären The Verve vielleicht nur ein gut gehütetes Geheimnis in britischen Indie-Kreisen geblieben. Das Video zum Song ist ikonisch, der Einsatz im großen Finale des Films Cruel Intentions sowieso. Wie aber für viele andere Bands wurde ihr tausendfach gecoverte Überhit The Verve beinahe zum Verhängnis. Das markante Streichermotiv, welches dem ganzen Track überhaupt erst seine Bittersüße einimpft, war nämlich gesampelt und zwar von den Rolling Stones oder besser gesagt der Interpretation vom Stones-Klassiker The Last Time durch das Andrew Oldham Orchestra. Fies daran war, dass The Verve vorher die Erlaubnis des Labels Decca für die Aufnahme eingeholt hatten, nicht aber für die zugrunde liegende Komposition von Mick Jagger und Keith Richards. Allen Klein, der für die Band die Rechte verwaltete, forderte satte 100% der Einnahmen und die vollen Credits für seine Klienten. So sicherte er seiner Firma ABKCO einen der größten Hit der Unternehmensgeschichte, konnte Millionen in die Kassen der Rolling Stones spülen lassen und haute The Verve gehörig in die Pfanne. Das Schlimmste daran? Die markante Melodie war eigentlich nicht Teil des Stones-Originals und Arrangeur David Whitaker, der das Riff geschrieben hatte, ging komplett leer aus.
4. Spiritualized – Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space
Der Ärger um den Riesenhit, der für The Verve den internationalen Durchbruch bedeutete, sah nach außen hin wie ein bösartiger Kommentar auf den Werdegang der Band aus. Die hatte mit Urban Hymns zwar einen musikalisch wesentlich breiter gefächteren Stil entwickelt, sich aber von ihren Wurzeln in der Psychedelic-Community entfernt. Der komplette Ausverkauf? Das mag so manche böse Zunge behauptet haben. Tatsächlich blieben The Verve natürlich Fans des Sounds, der sie in ihren Anfangstagen geprägt hatte. Das schloss nicht nur den kunterbunten Indie Rock der Madchester-Szene, sondern auch Gruppen wie Spacemen 3 und deren Nachfolgeband Spiritualized mit ein. Die veröffentlichten im selben Jahr wie The Verve ihr Opus Magnum: Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space wurde zu einem der Klassiker der neunziger Jahre. Auch diese Konkurrenz jedoch war in erster Linie eine musikalische, tatsächlich verstanden sich zumindest zwei Mitglieder von beiden Bands prächtig. Schon 1995 heiratete Richard Ashcroft die Spiritualized-Sängerin Kate Radley, die bei der Band auf allem spielte, was Tasten hatte: Piano, Orgel, Synthesizer. Radley allerdings stieg nach der Veröffentlichung von Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space direkt aus. Kein Wunder, war sie doch zuvor mit dem Spiritualized-Mastermind Jason Pierce liiert…
5. Funkadelic – I Got A Thing, You Got A Thing, Everybody’s Got A Thing
Madchester, Brit Pop, die Rolling Stones, Psychedlica made in England – scheint fast so, als hätten sich The Verve nie vor die Haustür getraut! Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ebenfalls auf Urban Hymns findet sich mit The Rolling People ein Song, der wabernde Funk-Riffs andeutete und mit satten Grooves voran rockte. Dass sich der deutlichste Einfluss der bleichen Lads aus Manchester ausgerechnet bei der legendären Funk-Kombo Funkadelic finden lässt, überrascht vielleicht einige. Tatsächlich hat Verve-Gitarrist Nick McCabe sich wohl den einen oder anderen Kniff von Funkadelic-Songs wie I Got A Thing, You Got A Thing, Everybody’s Got A Thing abgeschaut. Die nervösen und doch flächigen Riffs, die fiebrigen Rhythmen – das alles sollte sich später in seinem Spiel manifestieren. Als eine seine Lieblingsplatten nannte der Gitarrist Funkadelics Free You Mind… And Your Ass Will Follow. „Mein Vater kaufte sie für 20 Pence in einem Ramschladen“, erinnerte er sich im Online-Magazin The Quietus. „Das war derselbe Laden, wo ich alle meine Pedale herbekam. Zwanzig Pfund für meinen ersten Flanger und das war das, worauf das erste Verve-Album aufbaute – dieser Flanger.“ Dass Richard Ashcroft beim Kumpel vorbeikam, um gemeinsam mit ihm LSD einzuwerfen und Funkadelic in Endlosschleife zu hören, wird aber wohl auch geholfen haben.
6. Joy Division – I Remember Nothing
„Diese Funkadelic-Platte, die war’s“, gab McCabe zu den Acid-verseuchten Listening Sessions der beiden Jugendfreunde zu Protokoll. „Wir verglichen sie mit unserer ersten Demo, die dagegen wie Spielzeugmusik klang. Wir hatten eine Erleuchtung. Keine schmerzhafte, aber uns wurde klar, dass wir in die falsche Richtung gingen.“ Es hing, das war seit diesem Moment klar, vor allem an der Produktion. Der dreckige, schwüle Sound von Funkadelic war aber nur ein Eckpunkt von dem, was The Verve im Studio erreichen wollten. Ebenso wichtig wurden die ebenfalls aus dem Großbereich Manchester stammenden Joy Division, allem voran deren beklemmendes Debüt Unknown Pleasures. Das mag zuerst nicht einleuchten, denn Produzent Martin Hannett hatte der aufstrebenden Band um Ian Curtis einen ultrareduzierten Sound verpasst, der ohrenscheinlich nichts mit dem opulenten Sounddesign späterer Verve-Platten zu tun hatte. Was die Band sich bei ihm aber abschauten, waren die Subtilitäten und Feinheiten, die Unknown Pleasures zu einem Meisterwerk der Musikgeschichte machen. McCabe entdeckte die Band mit zehn Jahren durch seinen älteren Bruder und Unknown Pleasures war eine der ersten Platten, die sich der Gitarrist von seinem Geld als Milchausträger kaufte. Vor allem faszinierte ihn, wie Hannett mit klanglichem Raum umging. „Die Ganze ist so klamm… Ich hau jetzt alle Klischees über verlassene Industriegebäude raus, aber es klingt eben nach der Gegend, in welcher ich aufgewachsen bin“, sagte er über die Produktion der Platte. „Dieses zerschmetternde Glas auf I Remember Nothing und die Synthie-Drones…“ Kein Wunder, dass McCabe bald selbst an seinem Roland mit ähnlichen Sounds zu experimentieren begann.
7. Led Zeppelin – Stairway To Heaven
Ähnlich wie bei Joy Division lag der Fokus bei The Verve vor allem auf dem charismatischen Frontmann Richard Ashcroft, hinter dem McCabe, Bassist Simon Jones und Drummer Peter Salisbury sowie der später hinzugestoßene Gitarrist und Keyboard Peter Tong zu verblassen drohten. Durchaus freiwillig: Zu Interviewterminen tauchten die vier so gut wie nie auf. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre eigenen Rockstarallüren auszuprägen. Northern Soul-Produzent Owen Morris bezeichnete McCabe etwa als „ohne Zweifel den talentiertesten Musiker, mit dem ich jemals gearbeitet habe“, charakterisierte die Zusammenarbeit aber zugleich als kompliziert. „Er spielt nie dasselbe zweimal. Du kannst Noel Gallagher drum bitten, dieselbe Melodie hunderte Male in Folge zu spielen und solange es einen Grund dafür gibt, macht er das auch. Aber bei Nick hast du keine Chance.“ Okay, das klingt noch verhältnismäßig brav im Vergleich zu Salisburys destruktiven Hotelaufenthalten… Dennoch: Eine kleine Prise Größenwahn war bei The Verve immer die essentielle Zugabe, das gewisse Etwas. Eines der bandinternen Vorbilder sind nicht ohne Grund Led Zeppelin! Mit denen verglich Ashcroft die Band sogar, als er 2008 das zweite Comeback-Album der Bandgeschichte ankündigte. Und dass ihr Comeback-Album Forth vom Titel her an Led Zeps IV (sprich: „four“ oder eben „fourth“) erinnerte, mag da wohl kein reiner Zufall gewesen sein. Die Stairway To Heaven erklimmen zu wollen, war von Anfang an erklärtes Ziel von Ashcroft und seinen Kollegen.
8. DJ Shadow – Midnight In A Perfect World
Obwohl The Verve allein wegen ihrer Nähe zu Oasis häufig dem Brit Pop zugerechnet werden, greift diese rigide Schubladisierung doch zu kurz. Denn nicht nur in der experimentellen Psychedelic-Szene fand die Band ihre Inspiration, auch von Hip Hop wurden sie beeinflusst. Ashcroft nannte die Veröffentlichungen des britischen Downbeat-Labels Mo’Wax als einen Einfluss und McCabe zählt Mobb Deeps Rap-Klassiker The Infamous zu seinen Lieblingsalben. Deren entspannter Boom Bap-Sound schlug sich nicht zuletzt im abgehangenen Spiel von Peter „Sobbo“ Salisbury nieder. Dabei handelt es sich bei dem Drummer, der später bei Black Rebel Motorcycle Club und den Charlatans aushelfen sollte, doch um einen Hitzkopf erster Güteklasse. Und war nicht eigentlich die drug of choice der Band in ihren Anfangstagen noch Amphetamin – nicht grundlos unter dem Straßennamen Speed bekannt? Die Entschleunigung im Bandgefüge mag einiges mit der intensiven Beschäftigung mit der neuen, Sample-getragenen Musik von Produzenten wie DJ Shadow zu tun gehabt haben, mit dem Ashcroft sogar für einen Track kollaborierte. Shadows Album Endtroducing… erschien 1996 und krempelte die gesamte Musiklandschaft in einem Streich komplett um. Die subtilen Grooves von Tracks wie Midnight In A Perfect World fanden ihr Echo in Stücken wie Neon Wilderness von Urban Hymns, das ein Jahr später veröffentlicht wurde. Nach reichlich Speed und LSD hatte nun wohl die gute alte Mary Jane ihren Einzug in die Musik von The Verve gehalten.
9. Massive Attack – Unfinished Sympathy
Näher noch als der US-amerikanische Rap und Hip Hop oder die britische Downbeat-Szene stand The Verve der aus Bristol quellende Trip Hop, wie ihn Massive Attack prägten. Das ikonische Video von Bittersweet Symphony, in dem Richard Ashcroft stur durch die Straßen Londons stolpert, ist eine liebevolle Hommage an das nicht minder bahnbrechende Video zum Massive Attack-Song Unfinished Sympathy von ihrem Debütalbum Blue Lines. Nicht aber nur visuell, auch musikalisch verband beide Bands einiges. Die orchestralen und psychedelischen Elemente, die The Verve in die Rock-Musik überführten, fanden sich bei Massive Attack in gedämpften Hip Hop-Breaks eingebettet. Typisch Bristol, typisch britisch! In den USA allerdings kamen wohl genau deswegen weder The noch Massive Attack sonderlich gut zurecht, als sie 1998 gemeinsam auf Tour durch die Staaten gingen. Beide Bands wollten ursprünglich Konzerthallen mit einem Verfassungsvermögen von durchschnittlich 10 000 Menschen füllen, konnten aber nicht genug Tickets verkaufen. Die Gigs wurden flugs auf kleinere Venues umgebucht und irgendwann mittendrin warfen Massive Attack frustriert das Handtuch. Und obwohl Ashcroft noch munkelte, die Bristoler könnten gegen Ende der Tour wieder hinzustoßen, hieß es wenig später über einen Fan-Blog: „Ich habe gerade gehört, dass The Verve auf der Suche nach einem Support-Act für ihre restlichen US-Dates sind und dass es nicht Massive Attack sein werden.“ Ab da an hieß es wohl zwischen beiden Bands eher „finished sympathy“. Auch The Verve lösten sich wenig später zum zweiten Mal seit 1995 auf.
10. Gorillaz – Clint Eastwood
Was aber kam dann? In der Zeit zwischen der zweiten Auflösung und der zweiten Reunion von The Verve im Jahr 2007 rückten Brit Pop – oder sagen wir lieber: britischer Rock- und Pop-Musik – und Hip Hop beziehungsweise Trip Hop noch enger zusammen, als die Gorillaz die Bühne betraten. Die skurillen Comicfiguren im Tank Girl-Design debütierten 2000 mit der Single Clint Eastwood und bescherten der Welt den Ohrwurm des zu dieser Zeit noch frischen Jahrzehnts. Nicht aber nur Blur-Frontmann Damon Albarn war Teil der virtuellen Band, auch The Verve-Gitarrist Simon Tong gesellte sich zu ihnen, nachdem er 2002 Graham Coxon nach dessen Weggang von Blur für einige Live-Auftritten ersetzt hatte. Tong war aber nicht nur live, sondern auch mindestens zwei Mal im Studio Teil des verschrobenen Projekts: Auf den Alben Demon Days und Plastic Beach ist er auch zu hören. Sogar bei Albarns anderer Supergroup ohne Namen, die im Jahr 2007 das Album The Good, The Bad & The Queen veröffentlichte, war er dabei. Er wird es wohl also verkraftet haben, bei der zweiten Reunion von The Verve nicht in die Band eingeladen worden zu sein. Seine gemeinsame Band mit Verve-Bassisten Simon Jones hatte sich schließlich als Misserfolg entpuppt. Dabei war doch bei den 2000 gegründeten The Shining mit John Squire von Beginn an ein Musiker dabei, dessen Band für The Verve erst den Startschuss gaben: die Stone Roses.
Das könnte dir auch gefallen:
Die 15 berühmtesten Alter Egos der Musikgeschichte
Wer ist wer auf dem Sgt. Pepper Cover – Wir haben es entschlüsselt!