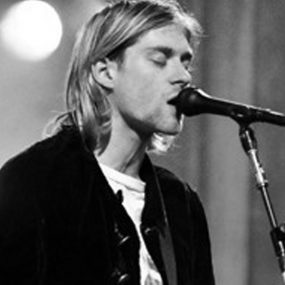Popkultur
Zeitsprung: Am 11.6.1991 hauen Skid Row mit „Slave To The Grind“ einen Hammer raus.

Anekdoten, Jubiläen und wilde Geschichten: Was an diesem Tag in der Welt der Musik passiert ist, lest ihr täglich in unserem Zeitsprung. Heute: 11.6.1991.
von Christof Leim
Als Skid Row am 11. Juni 1991 Slave To The Grind veröffentlichen, wundert sich die Headbangerschaft: Statt die erfolgreiche Hair-Metal-und-Balladen-Formel des 1989er-Debüts weiter auszuwalzen, legt der Fünfer aus New Jersey eine Schippe drauf. Gitarrist Dave „Snake“ Sabo blickt für den Zeitsprung zurück.
Hier könnt ihr euch das Machtwerk anhören:
Hatte der eingängig rockende, mehrfach platinveredelte Vorgänger Skid Row noch einigermaßen typisch für 1989 und den haargesprayten Stoff von Headbanger’s Ball geklungen, zeigen sich Skid Row nun rauer, böser und vor allem: größer. Während die Hair-Metal-Blase mit Hilfe von MTV immer weiter überdreht und zusehends dem großen Knall entgegensteuert, wählt die Band, als hätte sie es geahnt, die Gegenrichtung. Komplett aus der Zeit gefallen wirkt Slave To The Grind 1991 zwar nicht, die Platte markiert keinen Bruch im Stil der Band, aber einen deutlichen Schritt – vor allem nach vorne.
Absichtlich in die Gegenrichtung
So zeigen sich die Kompositionen vielseitiger, die Texte cleverer und die Performance aller Beteiligten voller Energie und Seele. Sänger Sebastian Bach nennt der Rolling Stone sogar „einen Mann, der aussieht und klingt, als sei er gentechnisch zum ultimativen Hard-Rock-Frontmann verändert worden“. Der damals 23-Jährige besitzt mit seinen arschlangen blonden Haaren und dem Engelsgesicht nicht nur das passende Auftreten und eine schier unerschöpfliche Rock’n’Roll-Energie, sondern auch eine Stimme, an die 1991 nicht viele heranreichen können. Nicht zuletzt klingt Slave To The Grind dank der fetten Produktion von Michael Wagener auch heute noch gut.

Skid Row 1991: Bolan, Snake, Affuso, Hill, Bach – Foto: Promo
Gitarrist Dave „Snake“ Sabo, damals 26, erinnert sich im Zeitsprung-Gespräch an die Attitüde und Geisteshaltung seiner Truppe: „Die zwei Jahre zwischen der ersten Platte und Slave To The Grind waren einfach überwältigend. Wir konnten gar nicht glauben, was da alles passiert ist. Allerdings haben sich auch die dunklen Seiten des Musikgeschäftes gezeigt: Wir durften hautnah erleben, dass der Künstler als eine Ware angesehen wird, obwohl alles auf seiner Schöpfung basiert. Auf den Touren haben wir gesehen, was das Business mit Persönlichkeiten und zwischenmenschlichen Beziehungen machen kann. Und je mehr wir von der Welt da draußen erfahren konnten, desto mehr hat das eine andere Seite von Skid Row hervorgebracht. Man lernt unterwegs Dinge, die einem keine Schule oder Universität der Welt beibringen kann. Wir waren uns auch der Tatsache bewusst, dass man, wie es so schön heißt, sein ganzes Leben hat, um die erste Platte zu schreiben, aber nur ein Jahr für die zweite.“
„Ihr werdet die Hälfte des Publikums verlieren“
Vor allem aber stört die fünf Musiker Mitte Zwanzig, dass sie in der Szene als eine weitere Achtziger-Glam-Band angesehen werden, mit hübschem Sänger und zwei Balladenhits (18 & Life, I Remember You). „Hinter Skid Row steckte immer schon eine Menge mehr“, findet Snake, „und wir mussten damals daran arbeiten, diese Wahrnehmung zu ändern. Unsere Liveshows kamen ohnehin ganz anders rüber. Deshalb steckte durchaus eine bewusste Entscheidung dahinter, Slave To The Grind härter zu machen. Uns haben einige Leute gesagt, dass wir vermutlich die Hälfte unseres Publikums verlieren würden.“
Los geht die Sause mit Monkey Business: Auf das clean gespielte Intro folgt ein Midtempo-Riff zur Cowbell, das schiebt wie 100 Traktoren. Mit der zweiten Single Slave To The Grind geben Skid Row noch mehr Gas. „Ich wollte unbedingt ein grandioses Intro für die Shows haben“, erklärt Snake, „sowas wie What You Don’t Know von Twisted Sister oder Detroit Rock City von Kiss – theatralisch und episch.“
Das Demo wummst am meisten
Weil die live eingespielte Demoversion des Titelstücks die größte Wucht besitzt, landet sie sogar auf der Platte, wie sich Michael Wagener erinnert: „Die Nummer haben wir in einer Stunde aufgenommen und abgemischt. Daran mussten wir nachher nichts mehr ändern.“ Bei der Plattenfirma scheint der neue Kurs indes noch nicht angekommen zu sein, denn im Video soll ein Bikinimodel mit sich wackeln. Das lehnt die Band rundheraus ab, zumal es im Text um die Freiheit des Individuums, nicht um Sex geht.
Für die herrliche, aber unkonventionelle Ballade Quicksand Jesus fangen sich Skid Row Schimpfe von religiösen Gruppen wegen angeblicher Gotteslästerei ein. Texter und Bassist Rachel Bolan kommentiert später in den Liner Notes der Best-of 40 Seasons: „Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.“ Bolan steckt auch hinter dem als 3D-Video veröffentlichten Psycho Love, das die Geschichte einer mordenden Prostituierten erzählt. Dass damals Angela Bowie ihren Ex-Mann David in unzähligen Talkshows durch den Dreck zieht, dient dem Bassisten, einem großen Fan des „Thin White Duke“, als Inspiration für Creepshow.
Ernste Themen und Partyalarm
Dass Skid Row nicht nur über ernsthafte Dinge schreiben wollen, zeigt sich im punkigen Rocker Get The Fuck Out über das wilde Partyleben und Groupie-Exzesse. Nach Genuss will man sich entweder die Hände waschen oder noch zwölf Bier trinken. Das Wörtchen „Fuck“ in der mit Rotz und Wumms gebrüllten Titelzeile kommt allerdings nicht überall gut an, so dass der Song auf einer bereinigten Version der Scheibe durch den guten, aber nicht großartigen Japan-Bonustrack Beggar’s Day ersetzt wird.
In A Darkened Room beginnt mit einer schönen Gitarrenmelodie und gipfelt in einem tollen, ausgedehnten Solo von Scotti Hill – hörenswert! Textlich greifen Skid Row hier das Thema Kindesmisshandlung auf, kein einfaches Unterfangen.
Gesangsbrillanz
Zum Schluss wird es dann mit Wasted Time richtig episch, einem Song über Drogen, auf traurige Weise inspiriert von einem alten Kumpel: Guns N’ Roses-Trommler Steven Adler. Die schön orchestrierte zwölfsaitige Akustikgitarre bewegt sich jenseits der üblichen Pfadfinderakkorde anderer Hard-Rock-Balladen und steigert sich zu einem massiven Chorus und dramatischem Outro. Insbesondere hier zeigt Bach, gefühlvoll schmachtend, druckvoll schreiend und jubilierend in den höchsten Lagen, welche Stimme in ihm steckt. Um es deutlich zu sagen: Zum Niederknien gesungen, die Nummer.
Slave To The Grind erscheint am 11. Juni 1991 und rauscht mit Schwung auf Platz eins der US-Charts. Das hat es vorher für Metal-Bands selten bis nie gegeben. Durch das gerade erst eingeführte elektronische Zählsystem für Plattenverkäufe namens SoundScan, das die früher gebräuchliche und ungenauere Schätzung durch die Läden ersetzt, scheinen sich die wirklichen Präferenzen der Kundschaft herauszukristallisieren. In Deutschland landet das Werk auf Platz zwölf und damit zehn Stufen höher als das Debüt.
Raus in die Welt
Gleich sechs Singles und Videos wirft die Platte ab, die nicht ganz unerwartet weniger Radioeinsätze erzielen als beim Debüt. Doch mit Slave To The Grind emanzipieren sich Skid Row von Welt der Hair-Bands mit ihrem quasi eingebauten Verfallsdatum. Stattdessen rücken sie eher in die Nähe von Metallica, die nur einen Monat später ihr monumentales Black Album veröffentlichen. Das Artwork für das Cover stammt übrigens von Sebastian Bachs Vater David Bierk.

Das Artwork von „Slave To The Grind“ in ganzer Breite, gemalt von David Bierk
Nach dem Erscheinen bestreiten Skid Row das Vorprogramm für Guns N’ Roses, die gerade mit Use Your Illusion alle Dimension sprengen. Größer geht es Anfang der Neunziger nicht. Dann gehen sie auf eigene Headliner-Tour mit Pantera und Soundgarden als Support. Größer als diese beiden geht es ein paar Jahre später nicht. Skid Row sind in alle Munde und in allen Medien, sogar B-Side Ourselves, eine EP mit Coverversionen, verkauft sich ein Jahr später noch mehr als eine halbe Million mal. Keine Frage: Mit Slave To The Grind haben Skid Row ihr Meisterstück abgeliefert. Man muss sich nur mal den ersten Song anhören, wenn nach der Cowbell das Riff reinkommt…
Zeitsprung: Am 24.1.1989 schlagen Skid Row mit ihrem Debüt mächtig ein.